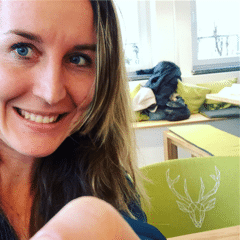Mens sana in corpore sano
Mens sana in corpore sano ?? ??
Dies ist ein besonderer Gastbeitrag, denn es ist unser erster zweisprachiger Post. Die wunderbare Sophie R. fühlt sich in beiden Sprachen so wohl, dass wir uns dachten: warum dann nicht beide Sprachen an Euch weitergeben? Das Thema des Textes lässt sich am besten in einem unserer Lieblingshashtags zusammenfassen: #healthybodyhealthymind – frei übersetzt also: Gesunder Körper, gesunder Kopf. Was das für Sophie heißt und wie sie es geschafft hat, von der Theorie in die Praxis zu kommen, lest ihr hier:
(wenn ihr direkt zum Deutschen Text springen wollt: einfach hier klicken)
This is a very special post for us, at it is our first bilingual one. The dear Sophie R. feels at home both in English and in German so that we thought: why not give you the joy of reading it as a double? And the topic is best explained in one of our favorite hashtags: #healthybodyhealthymind What this means for Sophie and how she made friends with her body – read on:
?? The other side of the coin
Mens sana in corpore sano – I don’t know how many times I’ve read that phrase. I always thought it just meant that exercising and keeping our bodies healthy also plays a role in our psychological well-being: If we don’t commit to being fit, our mind will somehow suffer. I always rolled my eyes at it a little bit, as the sentence seemed to exist exclusively to make me feel guilty about not exercising enough (or, sometimes, at all).
But I just realized that looking at it vice versa might actually be much more important: Only if we commit to keeping our minds healthy, our bodies can be completely healthy as well.
My body and I don’t have the best relationship. Back pain, muscle tensions, restless legs, skin diseases, upset stomach, nervous bladder, excessive fatigue… the list of stones my body has been putting in my path is long. It often just does not behave how I would want it to: I’m getting sick when I wanted to attend a party, I am getting stomach cramps when I was planning on eating in a nice restaurant with friends, my skin condition is catastrophic when I am supposed to take pictures.
My usual reaction is to be angry and annoyed. Way to go, body, thanks a lot for spoiling all the fun yet again! It must be hilarious to deny me everything I want or strive for. As a result, I am railing at it all the time: My body is both ugly and weak and I hate it. Can’t it just shut up for once?!
Don’t shoot the messenger
It just dawned on me that my rants are both silly and useless. I also don’t curse the warning light in my car that tells me the gas is running low, or that there is a problem with the motor, right? I might be annoyed with the fact that there is an issue, but it is definitely not the warning light’s fault.
It is equally foolish to scold at my body for signaling me that something is not right. It is trying to tell me that I need some rest. Or that my mind and soul are damaged and need care. It’s asking me for help. And what do I do? I cover up the light, or I even hit it with a hammer until it stops to shine: I drink tons of coffee, I take pills, I unsuccessfully consult with doctors and I am angry at the enemy I am forced to live in. And then I am appalled when the car simply stops at some point.
Instead of complaining about not being able to keep moving, I should be thankful that the fact that the car stopped working in the middle of the road did not result in a bad accident for now, but merely in a break. Maybe this is a good time to check if I was driving in the right direction at all… ?
It is not my body’s fault that something needs fixing. It is mine for not taking good care of my mental health. I should really start to see my body as my partner and listen to it more closely.
A gap between mind and body
That is easier said than done, though. It is strange, but I feel somehow cut off from my body sensations. It became very apparent in a physiotherapy session a few weeks ago: The therapist would ask me to take a certain position, then change it and tell her what felt different in my body. I tried really hard, but I did not notice any difference whatsoever. I felt like I was failing at a task, and therefore I tried to guess what she wanted me to say.
Of course, she noticed. She told me that there is no right or wrong and that everybody perceives things differently. But she didn’t say anything about feeling literally nothing. I seem to be completely disconnected from my body. Thinking about that now, since I clearly can’t feel small changes, I guess it is not too surprising my body needs to resort to more drastic measures in order to get me to listen.
Now that I am aware of my error in reasoning, I feel really bad about how I have been treating my body. I need to slow down in order to be able to also hear its soft cries – it should not be forced to scream. I would like to close the gap between my mind and body – I want them intertwined.
My focus has been on my mind for far too long. It’s time to move things out of my head and into my body, to stop thinking and start doing .
Connect what’s disconnected
To give you an example, I have considered trying out meditation and mindfulness techniques for ages. I read articles and listened to podcasts highlighting the benefits of it; spent hours dreaming about how great it would be to be able to shut up the mind for a bit and simply focus on my breath. I even gave it a go a couple of times – of course, it did not work right away. But actually practice it and make it a habit? Nope, I couldn’t be bothered. I’d rather read another book about it. Enough! From now on, my thoughts will be followed by actions.
I also want to act more on my gut feeling: Take decisions based on intuition and confidently stick with them rather than rationalizing for ages, juggling pro/con lists in my head, taking ages to decide something, and already questioning it the day after.
Consulting back with my body before doing something seems like a good idea in general. Do I really want to keep eating or am I already full? Do I really want to go out for drinks tonight or would I prefer some quality alone-time with a book? Do I really want to run another round in the park (because then it would be 5 and not hitting that bar would undoubtedly mean I am a failure …) or is my body craving some rest because it already ran 5 rounds for 3 days in a row?
I definitely won’t be able to implement all of this overnight. This war has lasted for years after all. But I hope my body will notice that I am willing to cooperate. A ceasefire is the first step to peace!
?? Die andere Seite der Medaille
Mens sana in corpore sano – wie oft habe ich diese Redewendung gehört. Und dachte immer, es bedeutet eben, dass man seinen Körper fit halten muss, weil die Psyche sonst irgendwie darunter leidet. Innerlich habe ich dann immer genervt die Augen verdreht. Ich hatte das Gefühl, dieser Satz existiert einzig und allein, um mir wegen meiner mangelnden Sportambitionen ein schlechtes Gewissen zu machen.
Aber jetzt ist mir aufgefallen, dass man es auch genau anders herum sehen kann. Und das vielleicht sogar noch wichtiger ist: Nur, wenn man sich aktiv darum bemüht, seinen Geist gesund zu halten, kann auch der Körper wirklich gesund sein.
Mein Körper und ich haben nicht gerade die beste Beziehung, die man sich vorstellen kann. Rückenschmerzen, Verspannungen, Restless Legs, Hautkrankheiten, Magenprobleme, Blasenentzündungen, übermäßige Müdigkeit… die Liste der Steine, die mein Körper mir regelmäßig in den Weg legt, ist lang. Er macht generell verhältnismäßig selten, was ich will:
Ich werde krank, wenn ich eigentlich auf eine Party gehen wollte. Ich bekomme Magenkrämpfe wenn ich mit Freunden im Restaurant verabredet bin. Meine Gesichtshaut ist dann besonders irritiert, wenn ich Fotos machen soll. Normalerweise bin ich dann wütend und genervt. Super, Körper, vielen Dank, dass du mir mal wieder den Spaß verdirbst! Muss ja urkomisch sein mir jedes Mal einen Strich durch die Rechnung zu machen.
Dementsprechend bin ich nur am Fluchen: Mein Körper ist hässlich und schwach und ich hasse ihn einfach. Kann er sich nicht EINMAL ruhig verhalten?
Der Überbringer der Nachricht kann nichts dafür
Nach und nach wird mir aber klar, dass meine Schimpftiraden nicht nur albern, sondern auch sinnlos sind. Ich bin ja auch nicht sauer auf die Warnleuchte im Auto, die mir mitteilt, dass das Benzin bald leer ist, oder dass mit dem Motor etwas nicht stimmt. Ich bin vielleicht genervt, DASS es ein Problem gibt, aber es ist ja nun wirklich nicht die Schuld der Warnleuchte.
Es ist genauso sinnfrei, meinen Körper dafür anzumeckern, dass er mir zu verstehen gibt, dass etwas nicht stimmt. Er will mir sagen dass ich eine Pause machen muss, oder dass meine Psyche angeschlagen ist und etwas Pflege braucht. Er bittet mich um Hilfe. Und was mache ich? Ich decke die Warnleuchte ab, oder schlage so lange mit einem Hammer darauf, bis sie aufhört zu leuchten: Ich trinke literweise Kaffee, ich nehme tonnenweise Tabletten, ich renne ständig zu Ärzten, die mir am Ende auch nicht weiterhelfen können und bin im Großen und Ganzen sauer auf den Feind, in dem ich leben muss. Und dann wundere ich mich, wenn das Auto irgendwann nicht mehr fährt.
Anstatt mich zu beschweren, dass ich nicht weiterfahren kann, sollte ich dankbar dafür sein, dass es nicht zu einem größeren Unfall geführt hat, dass das Auto mitten unter der Fahrt den Geist aufgegeben hat. Ich mache gerade nur eine Pause auf dem Seitenstreifen. Vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt um auf der Karte nachzuschauen, ob ich überhaupt in die richtige Richtung gefahren bin… ?
Es ist nicht die Schuld meines Körpers, dass etwas repariert werden muss. Es ist meine, weil ich nicht auf meine psychische Gesundheit aufgepasst habe. Wahrscheinlich sollte ich anfangen, meinen Körper als meinen Partner zu sehen und ihm genauer zuzuhören.
Eine Kluft zwischen Geist und Körper
Das ist allerdings leichter gesagt, als getan. Es klingt komisch, aber ich fühle mich irgendwie von meinen Körperempfindungen abgeschnitten. Das wurde in einer Physiotherapiestunde vor ein paar Wochen sehr deutlich: Die Therapeutin hatte mich gebeten, eine bestimmte Position einzunehmen, sie dann zu verändern und ihr zu sagen, was sich jetzt anders anfühlt. Obwohl ich die beiden Positionen ein paar Mal hintereinander gewechselt und verzweifelt ich mich hineingehört habe – ich konnte beim besten Willen keinen Unterschied wahrnehmen. Also habe ich geraten, was sie wohl hören will.
Natürlich hat sie es bemerkt und meinte, dass es kein Richtig oder Falsch gibt, und dass jeder die Dinge anders wahrnimmt. Aber überhaupt nichts wahrzunehmen war anscheinend eigentlich keine der Optionen. Es kommt mir so vor, als wäre ich nicht mit meinem Körper verbunden. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ist es eigentlich logisch, dass mein Körper drastischere Maßnahmen ergreifen muss, um mich endlich zum Zuhören zu bewegen.
Jetzt, wo ich meinen Denkfehler erkannt habe, habe ich ein ziemlich schlechtes Gewissen, dass ich meinen Körper so behandle. Ich wünsche mir, dass ich schaffe zur Ruhe zu kommen, zu entschleunigen, damit ich es auch hören kann, wenn er nur leise weint – er sollte nicht dazu gezwungen sein, mich anzuschreien. Ich würde gerne eine Brücke zwischen meinem Körper und meinem Geist bauen, sodass sie am Ende wieder harmonisch zusammenspielen können.
Mein Fokus lag viel zu lange auf meinem Geist. Es ist Zeit, ins Tun zu kommen, anstatt immer nur zu denken.
Brücken bauen
Ein Beispiel: Ich will seit Ewigkeiten Meditation und Achtsamkeitsübungen als feste Gewohnheit in meinem Alltag etablieren. Ich lese Artikel, in denen die vielen Vorteile aufgezählt werden, und höre Podcasts mit Tipps zur Fokussierung, stelle mir stundenlang vor wie toll es wäre, meine Gedanken für eine Weile ausschalten und mich einfach nur auf meinen Atem konzentrieren zu können. Ich habe es auch öfter ausprobiert, aber natürlich hat es nicht sofort funktioniert und ich habe mich schnell ablenken lassen. Aber wirklich über einen längeren Zeitraum konsequent zu üben? Nee, lass doch mal lieber noch ein Buch darüber lesen! Es reicht. Von jetzt an will ich meinen Gedanken Taten folgen lassen.
Ich möchte auch wieder mehr auf meine Intuition achten: Entscheidungen nach Bauchgefühl treffen und dann selbstbewusst dabei bleiben anstatt ewig zu grübeln, Pro-/Kontra-Listen zu führen, Wochen für die Entscheidung zu brauchen und sie dann am nächsten Tag gleich wieder in Frage zu stellen.
Rücksprache mit meinem Körper zu halten, bevor ich etwas tue scheint mir generell eine gute Idee zu sein. Will ich wirklich weiter essen oder bin ich schon voll? (s. auch Gastbeitrag von Anni: Iss doch einfach!) Will ich heute wirklich mit Freunden etwas trinken gehen oder würde ich eigentlich Ruhe und ein gutes Buch vorziehen? Will ich wirklich noch eine Runde im Park laufen (weil dann wären es 17 Uhr, und ich wäre ein totaler Versager wenn ich die fünf Runden nicht schaffe…) oder sehnt sich mein Körper nach einer Pause, weil er nämlich die letzten 3 Tage in Folge auch schon 5 Runden gerannt ist?
Ich werde es sicher nicht schaffen, das über Nacht umzusetzen. Der Krieg zwischen mir und meinem Körper hat schließlich Jahre gedauert. Aber ich hoffe, dass mein Körper merkt, dass ich grundsätzlich kooperieren möchte. Ein Waffenstillstand ist der erste Schritt auf dem Weg zum Frieden!