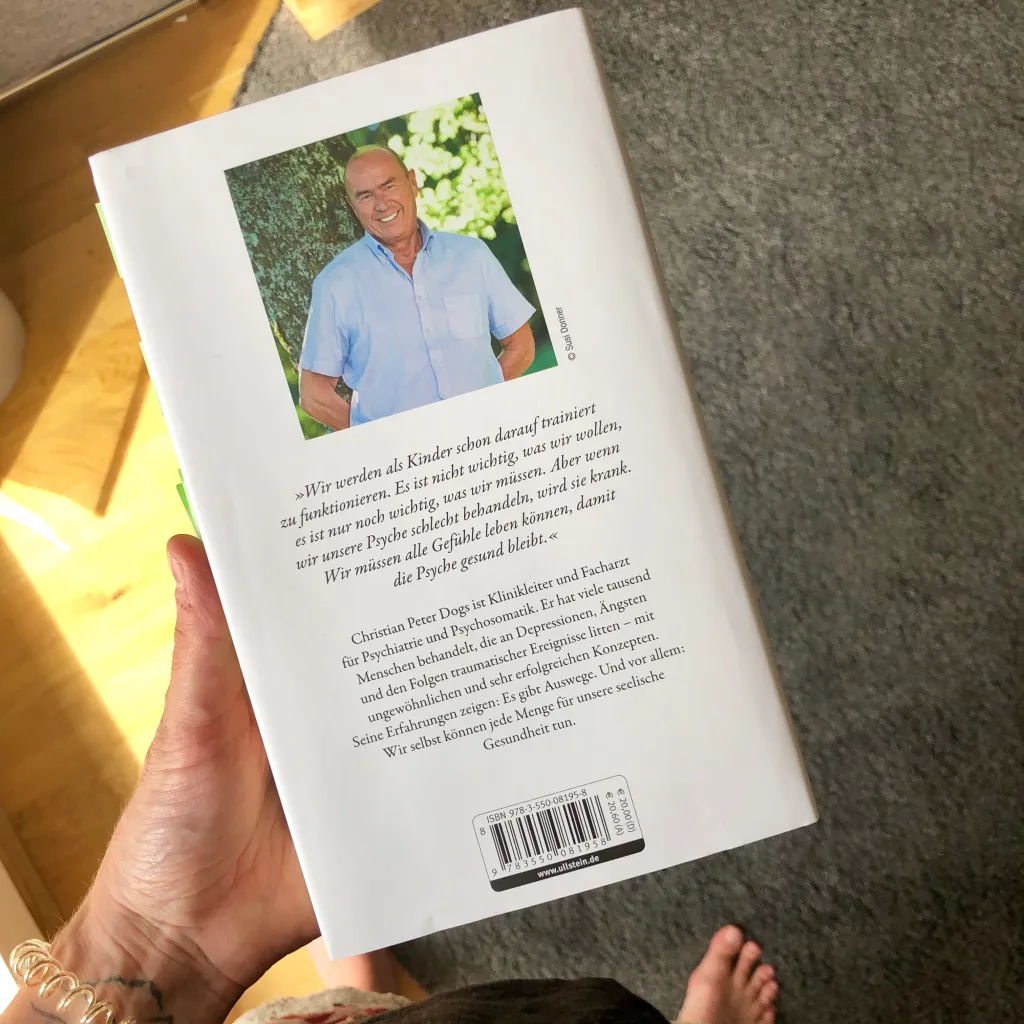Die Dunkelheit lässt grüßen
Die Dunkelheit lässt grüßen
Ein Post über Dunkelheit, über Kämpfe, die Hoffnung, Unterschiede und wie es so geht und steht. Da mal wieder die Zeit für klare Worte gekommen ist, an dieser Stelle vorsichtshalber eine ***triggerwarning***. Aber keine Angst – mir geht’s gut.
Dieser Beitrag ist vielleicht etwas emotionaler als gewohnt. Heute ist der 10. September 2019 – Welttag der Suizidprävention. Ist per se schon irgendwie ein emotionales Datum. Dazu sind dieses Mal die Akkus leer von zwei Tagen auf dem Streetlife-Festival. Und leere Akkus machen bei mir zuverlässig Tür und Tor für allerlei Emotionen auf.
WORLD SUICIDE PREVENTION DAY
Aber von Anfang an: finde ich viele Jahres- und Pseudofeiertage doch sehr dümmlich bis überflüssig („Welttag des Nutellabrotes“ & Co) so gibt es da doch auch ein paar von ihnen, über die ich froh bin, die ich wichtig finde. Ganz vorne stehen hier der 10. Oktober als WORLD MENTAL HEALTH DAY. Und eben der 10. September als Welttag der Suizidprävention.
Dass Suizid in meinen Gedanken über viele Jahre viel Raum eingenommen hat, habe ich schon des Öfteren geschrieben (u.a. hier). Dieser Tag ist sozusagen immer eine kleine Feier für mich, dass es mich noch gibt. Dass meine Krankheiten es nicht geschafft haben, mit endgültig das Leben zu nehmen. Er ist für mich Anlass, meinem früheren Ich fürs Durchhalten zu danken. Ebenso bin ich an diesem Tag wohl noch ein Stück dankbarer für mein heutiges Leben als sonst.
Es ist aber auch ein Tag, an dem ich an die vielen Menschen denke, die den Kampf nicht gewonnen haben. Ich denke an alle 53 Minuten, in denen sich ein Mensch in Deutschland das Leben nimmt. Und ich denke an alle 5 Minuten, in denen es jemand versucht. Ich denke an die Angehörigen, die zusätzlich zur Trauer auch noch mit Vorwürfen und Schuldgefühlen leben müssen. Und an eine Politik, die kaum Geld für Präventionsmaßnahmen ausgibt.
Ich denke dran, für wie viele Menschen Suizid jeden Tag ein Thema ist. Und dass ein Welttag eigentlich gar nicht ausreicht. Und dennoch ist es gut, ihn zu haben. Weil sich heute viele Menschen, Accounts und Medien dem Thema widmen. Und es ist auch für mich der Anlass, nochmal ein paar ehrliche Worte in diesem Zusammenhang zu verlieren.
„Hello darkness my old friend…“
Und ehrlich sein heißt in diesem Zusammenhang, auch mal drüber zu reden, dass es auch heute Phasen gibt, in denen ich auf die Frage „Wie geht’s?“ meinem Gegenüber am liebsten entgegen schreien würde „Scheiße geht’s! Ich hab da eine Krankheit in meinem Kopf sitzen, die mich zerstören, die mich sterben sehen will. Die es immer wieder schafft, dass ich an mir, am Leben, an allem zweifle. Die mir jegliche Freude, jede Hoffnung, jede Lust und jedes andere schöne Gefühl raubt.“
Ihr gegenüber steht meine Ratio. Mit all dem, was wahr ist, was stimmt, was ich gelernt habe und heute den Menschen mit auf den Weg gebe wenn ich für und mit meiner Mission unterwegs bin. Aber all das schützt mich nicht in vollem Umfang vor der Depression. Vor der Dunkelheit.
Ich frage mich manchmal, ob der Gedanke an Suizid auch bei „normalen“ Menschen ohne Depressions-Geschwür im Kopf so viel Raum einnimmt. Für mich ist es ganz normal zu denken „Na, wenn sich das und das Problem nicht erledigt, dann erledige ich eben mich. Und das Problem ist kein Problem mehr.“ Für mich ist das ein normaler Gedanke, der nicht gleich heißen muss, dass ich suizidal bin.
Wenn der Akku leerer wird, die Tage und Gedanken schwerer, dann kämpfe auch ich mit meiner Struktur, meinem Willen, meinen Vorsätzen. Dann tauchen da Gedanken auf, die ich eigentlich schon aus meinem Kopf raustherapiert hatte. Aber von denen wohl doch noch ein kleines Stück übrig geblieben ist, dass wachsen und wuchern kann. Und dass von dann auf wann, wenn ich eben mental geschwächt bin, einen neuen Angriff startet. Worauf hin meine mentale Abwehr aus Ratio, Therapie und Erfahrung loszieht um sich in den Kampf zu werfen.
Auf festem Boden
Und ja, es gibt Phasen, da möchte ich nicht mehr kämpfen. Denn ich will es nicht beschönigen: der Weg den ich hier gegen, mit meinen Krankheiten gehe, ist noch lange nicht zu Ende. Und auch die Anstregung, die es kostet, sich jede Sekunde dagegen zu wehren. Nicht nachzugeben, sondern dranzubleiben.
„Aber du sagst doch immer, dass heute Du Deine Krankheiten kontrollierst und nicht mehr Deine Krankheiten Dich? Das klingt hier eher irgendwie anders rum.“ – und darauf kann ich entschieden antworten – wäre ich nicht mittlerweile so gut darin, meine Krankheiten zu kontrollieren, wäre schon lange wieder eine Rasierklinge in meiner Haut, ein Schluck Alkohol in meinem Körper und der letzte Rest Hoffnung verschwunden. Eben weil ich heute so stark, so stabil bin gelingt es mir, auch in diesen Phasen Stand zu halten. Auch wenn die Depression es schafft, dass Borderline und Sucht mit an mir zerren.
Entscheidender als die Frage, ob es auch heute noch diese Dunkelheit in meinem Leben gibt, ist wohl die Frage, ob sich die Dunkelheit heute von der Dunkelheit damals unterscheidet? Ob sie sich anders anfühlt als früher? Darauf lautet die Antwort: Ja und Nein.
Nein, es fühlt sich nicht wirklich anders an. Denn die Hoffnungslosigkeit, die Gedanken und Gefühle sind fast die gleichen wie früher. Der Schmerz, die Erinnerungen, die Trauer, die Angst, das Grübeln. Und dieses absurde Gefühl, mir einerseits ein Leben ohne mich selbst vorstellen zu können, gleichzeitig vor alltäglichen Dingen Angst zu haben.
Anpfiff: Dunkelheit vs. Hoffnung
Und ja, es fühlt sich absolut anders und irgendwie gar nicht mehr wie früher an. Denn ich erlebe das alles heute sozusagen bewusst. Kann mir regelrecht zuschauen, wie ich kämpfe, mich versuche zu wehren, scheitere, falsche Entscheidungen treffe. Höre die Depression in meinem Kopf absurde Sachen sagen. Und während ein Teil von mir sofort drauf anspringt steht der andere Teil da und denkt sich „Echt jetzt?!“ Es ist ein bisschen so, als würde dieser Teil, der genau checkt was abgeht, gerade nicht am Steuer sein. Sondern der andere, der sich nach und nach von der Depression nach unten ziehen lässt, ihr jedes Wort glaubt.
Stellt man sich meine Psyche wie ein Fußballspiel vor dann ist die Depression die böse gegnerische Mannschaft. Der Coach – der Ratio-Teil in meinem Kopf – hat meine Mannschaft vorher vor allen Tücken gewarnt und gepredigt, sich nicht davon irritieren zu lassen. Sobald das Spiel beginnt, steht der Coach aber nur noch am Rand und kann wenig machen. Er kann meinen Spielern zu rufen und brüllen, gute Ratschläge und die Warnungen wiederholen. Aber spielen muss mein Kopf schon selbst. Das ist für den Coach manchmal ganz schön schwer mit anzusehen.
Und natürlich sind dann da auch ganz oft und schnell Selbstvorwürfe à la „Also eigentlich solltest Du das inzwischen ja besser wissen“ mit von der Partie. Ich laufe sozusagen sehenden Auges und wissenden Kopfes in der Dunkelheit herum. Das war früher nicht so.
Denn wohl der größte Unterschied zu früher ist, dass ich damals nicht gemerkt habe, wie tief ich in der Dunkelheit steckte. Oder besser: DASS ich überhaupt in der Dunkelheit steckte. Weil es ja normal für mich war. Heute weiß ich, dass es nicht normal ist, dass es anders geht – und meistens auch anders ist. Und ich weiß, oder zumindest ein Teil von mir weiß, dass das wieder vorbei geht. Aber das ist eben das fiese – steckt man drin, fühlt es sich absolut an. Bzw. absolut nicht so, als könnte es irgendwann wieder anders werden.
Geben und Nehmen
Und das ist der Punkt, an dem die Ratio, all die Therapie ihre große Stunde hat. In der sie mir heldenhaft zur Seite springen kann und mir ins Ohr flüstern oder entgegen schreien kann, dass es nicht so bleibt. Dass es wieder anders wird. Halbzeitpause. Der Coach kann in der Kabine nochmal ordentlich auf seine Mannschaft einreden. Das ist der Punkt, an dem mir die sozialen Medien helfen, weil dort immer jemand genau die richtigen Worte findet, die ich gerade hören muss. Ob ich selber schreibe und Reaktionen bekomme oder einfach nur passiv konsumiere, aufsauge. Hier bekommt mein eigener Coach sozusagen Unterstützung von außen.
Den Großteil meiner Arbeit, meiner Zeit bin ich diejenige, die anderen Mut, Hoffnung, Stärke, Zuversicht gibt. Die sagt, dass es besser wird. Oder die einfach nur da ist. Bin ich der Coach auf dem Spielfeld der anderen. Ab und zu aber bin ich eben nach wie vor auf der anderen Seite, stehe selber auf dem Spielfeld und freue mich, dass ich inzwischen so viele Menschen gefunden habe, die mir dann das geben, was ich so gerne verteile.
Wenn der Gedanke „Wie lange kenne ich diese Phasen jetzt schon? Wie lange werden sie mich noch begleiten?“ mal wieder groß wird, dann von außen zu hören, dass diese Phasen eben nur das sind. Phasen. Und gerade dann zu akzeptieren, dass diese Phasen eben zu mir gehören, weil die Krankheit Depression zu mir gehört. Nicht zu Erstarren davor, weil ich nicht weiß, ob mein Leben irgendwann frei sein wird von diesen Gedanken. Oder ob sie eben immer da sein werden. Sondern im Moment zu bleiben und mir jetzt das zu geben, was ich brauche.
#redenhilft – ist aber verdammt schwer
Und da ist der nächste Knackpunkt. Denn die Depression, die Dunkelheit isoliert mich. Nicht nur von all dem Wissen, von der Theorie – sondern auch von meiner Umwelt, von meinen Mitmenschen, Freunden und auch von Lasse. Von meinem inneren Coach, aber auch von allen äußeren.
Schon damals in der Klinik in Hamburg, als wir uns auf die Suche nach unseren „Frühwarnzeichen“ machen sollten, an denen wir merken, dass es bald krachen könnte, habe ich bemerkt, dass in-die-Augen-schauen bzw. dies nicht mehr tun zu können ein recht verlässliches Zeichen bei mir ist, dass was im Anmarsch ist. Auch Berührungen jeglicher Art werden dann für mich schwierig (aber weiter vollzogen, damit ich nicht auffalle).
Sage ich sonst, ach was, predige ich #redenhilft – so ist es genau das, was ich in diesen Phasen nicht kann. „Ich denke darüber nach, zu trinken / mich zu ritzen / Suizid zu begehen“ – das kommt einfach schwer über die Lippen. Vor allem weil die meisten Gegenüber nicht wissen, dass das darüber nachdenken noch wenig mit der tatsächlichen Handlung zu tun hat. Aber es macht Angst, wenn man solche Sätze aus dem Mund eines geliebten Menschen oder Freundes hört. Und ich möchte niemandem Angst machen.
Reden also geht nicht, schreiben aber geht. Und so hat mir schon mancher Text hier auf dem Blog, manch Post geholfen. Weil ich so teilen kann, was mit mir los ist, ohne wirklich reden zu müssen. Und weil ich weiß, dass das oft um einiges einfacher sein kann, gebe ich diesen Hinweis gerne weiter. Auch können sich aus diesen Posts dann Gespräche entwickeln – weil das schwierigste schon hinter mir liegt.
Worte aus der Dunkelheit
Vor wenigen Wochen erst war die Dunkelheit mal wieder zu Besucht. Einiges aus diesem Post stammt aus dieser Phase. Hier ein kleiner, ungeschliffener Abschnitt:
Gerade habe ich offensichtlich eine solche Phase. Bis dieser Artikel bei euch ist, könnte es trotzdem noch ein wenig dauern. Bis ich das schnell geschriebene sortiert und für euch verständlich verpacken kann. Aber es war mir wichtig, aus diesem Gefühl herauszuschreiben. Nicht aus der Erinnerung heraus, denn das verzerrt und verfälscht. Jetzt gerade, heute, am Sonntag den 21. Juli stecke ich in einer solchen Phase. Merke, wie die Depression in mir tobt, meine Gedanken dunkel färbt und auch Selbstverletzung, Suizid und Konsum eine Rolle in meinem Kopf spielen.
Schon die letzten Tage habe ich gespürt, wie ich insgesamt schwerer wurde. Dass ich dann noch in diversen Kontexten mit dem Thema Suizid konfrontiert wurde, war sicherlich nicht hilfreich. Gehört aber zu meinem Job dazu und ist meistens auch kein Problem für mich. Aber wenn man eh schon ein wenig aus dem Gleichgewicht ist, dann reicht eben ein kleiner Schubs in die falsche Richtung und eh man sich versieht ist man gefallen.
Wer das jetzt gelesen hat, und sich Sorgen macht oder Angst um mich hat, dem darf ich diese Sorgen und Ängste getrost wieder nehmen. Wenn es mir auch immer noch schwer fällt, das um Hilfe bitten und so, so habe ich doch inzwischen des Öfteren bewiesen, dass ich es doch kann. Wenn es hart auf hart kommt. Und immer öfter auch schon davor.
Seelisch ungeschminkt
Was ich wohl hauptsächlich mit diesem Artikel zeigen wollte ist, dass eben auch diese Gedanken, diese Seiten weiter dazu gehören. So zu tun, als ob das nicht der Fall wäre, hat schon einige meiner Kollegen kaputt gemacht (z.B. Amy Bleuel, die Initiatorin des Semikolon Projects). Mental Health Advocates, die nicht mehr geschafft haben ehrlich zu kommunizieren, dass es auch ihnen nicht immer gut geht. Aus Angst vor den Reaktionen ihrer Leser und Follower. Und sich eine zweite, eine neue Maske aufgebaut haben. Hinter der starken Rolle in Recovery. So ein Spiel will ich mir und euch einfach ersparen.
Oft wird auf Instagram der Hashtag #fürmehrrealitätaufinstagram verwendet. Leider meiner Meinung nach zu oft noch für äußerliches. Da wird sich dann ungeschminkt gezeigt und verkündet, wie wohl man sich doch in seiner Haut fühlt. Ich zeige mich in gewisser weise mit Posts wie diesem mental ungeschminkt, lasse euch an meiner Realität teilhaben. Eine Realität, die heute zu mindestens 85% hell und geil ist – aber deswegen dürfen die dunkleren 15% nicht unter den Tisch fallen. Eine Realität mit Gedanken und Phasen, die mir Angst machen, mich verunsichern – und das auch ok ist. That’s life with depression. Oder wohl einfach: That’s life.
Alleine zu akzeptieren, dass Tage wie heute eben emotional und bedeutsam für mich sind und ich mich dafür nicht schämen oder mir Vorwürfe machen muss, ist ja so ein Schritt. Und so denke ich heute, am Welttag der Suizidprävention, auch an euch – an meine Mission, meine Arbeit, die MENTAL HEALTH CROWD. Ich denke daran, was wir alles gemeinsam bewegen, verändern, schaffen können. Und dann wird die Welt, meine Welt gleich wieder ein Stückchen heller.
P. S.: Und für alle, die noch nicht restlos beruhigt sind, dass dieser Artikel wirklich quasi genau das Gegenteil eines Grundes ist, dass ihr euch um mich Sorgen machen müsstet: vor kurzem wurde bekannt gegeben, dass es bald einen neuen Dr. Strange Kinofilm geben wird. Er kommt am 7. Mai 2021 raus. Wir sehen uns im Kino.